Die Getöteten waren Söhne und Töchter, Geschwister, Eltern, Freund_innen, Nachbar_innen. Sie hatten ein Leben, Träume und Hoffnungen. Ihre Geschichten sichtbar machen, ihre Namen nennen, um sie dem Vergessen zu entreißen – diesem Gedanken folgt der Hashtag #SayTheirNames, der von den Hinterbliebenen des rechtsterroristischen Attentats in Hanau 2020 initiiert wurde. Das ist ein wichtiger Schritt, um die Opfer als Individuen sichtbar zu machen, sie in den Mittelpunkt zu rücken, nicht die Täter_innen – und damit auch die Logik der Tat, nämlich die Opfer unsichtbar zu machen, zu durchbrechen.
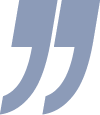
„Jedes Todesopfer rechter und rassistischer Gewalt hat eine Anerkennung und Achtung seiner Menschenwürde verdient. Das halte ich für ganz wichtig. Ich hoffe, dass die Menschenwürde der Opfer damit geachtet wird, wenn ein Gedenkort entsteht. Und ich würde mir wünschen, dass viel Menschen motiviert werden, die Möglichkeit zu Gedenken wahrnehmen und vielleicht die Botschaft daraus für sich mitnehmen, dass man – oder frau – als Demokrat oder Demokratin einfach Zivilcourage zeigen muss.“
Heide Dannenberg, Lebensgefährtin von Helmut Sackers
der am 29.04.2000 in Halberstadt von einem Naziskin erstochen wurde.
Gestorben, aber nicht vergessen!
 „Say their names“ beinhaltet auch die Forderung der Hinterbliebenen, die Getöteten nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und – endlich – Konsequenzen aus den unzähligen Fällen zu ziehen, in denen Menschen durch rechte und rassistische Gewalt ums Leben kamen. Denn Erinnern bedeutet viel mehr als nur: nicht zu vergessen. Es umfasst auch mehr als bloße Betroffenheitsgesten an Jahrestagen. Erinnern bedeutet, die Getöteten zu würdigen, ihnen ihre Namen zurückzugeben und die Taten anzuklagen. Und Erinnern meint, aus Fehlern zu lernen, um sie nicht zu wiederholen. Aufzuklären und einzugreifen anstatt wegzuschauen und wegzuhören. Eine aktive Erinnerungskultur ist mit dem Heute verbunden und deutet das Vergangene mit Blick auf die Zukunft. Denn würdiges Gedenken ist gleichzeitig eine Mahnung – eine Mahnung, sich mit den Ursachen der Taten, mit Rassismus, Sozialdarwinismus, Antisemitismus und Neonazismus auseinanderzusetzen und ihre mörderischen Auswirkungen sichtbar zu machen und sie zu bekämpfen.
„Say their names“ beinhaltet auch die Forderung der Hinterbliebenen, die Getöteten nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und – endlich – Konsequenzen aus den unzähligen Fällen zu ziehen, in denen Menschen durch rechte und rassistische Gewalt ums Leben kamen. Denn Erinnern bedeutet viel mehr als nur: nicht zu vergessen. Es umfasst auch mehr als bloße Betroffenheitsgesten an Jahrestagen. Erinnern bedeutet, die Getöteten zu würdigen, ihnen ihre Namen zurückzugeben und die Taten anzuklagen. Und Erinnern meint, aus Fehlern zu lernen, um sie nicht zu wiederholen. Aufzuklären und einzugreifen anstatt wegzuschauen und wegzuhören. Eine aktive Erinnerungskultur ist mit dem Heute verbunden und deutet das Vergangene mit Blick auf die Zukunft. Denn würdiges Gedenken ist gleichzeitig eine Mahnung – eine Mahnung, sich mit den Ursachen der Taten, mit Rassismus, Sozialdarwinismus, Antisemitismus und Neonazismus auseinanderzusetzen und ihre mörderischen Auswirkungen sichtbar zu machen und sie zu bekämpfen.
In Brandenburg setzen sich an mehreren Stellen lokale Gedenkinitiativen genau dafür ein. Sie schauen hin, wo andere wegsehen, recherchieren, fordern Aufklärung und Anerkennung, etablieren eine Kultur des Gedenkens – kreativ, empathisch und politisch. Das ist oft nicht einfach, sind doch die meisten Todesopfer rechter Gewalt in Brandenburg aus dem öffentlichen Gedächtnis verschwunden. Nichts erinnert im öffentlichen Raum an sie, keine Gedenktafeln am Tatort, keine Straßennamen, keine Gedenkveranstaltungen. Nach Gesten der Anteilnahme oder feierlichen Ansprachen von politisch und gesellschaftlich Verantwortlichen direkt nach der Tat blieben die Angehörigen und Freund_innen der Getöteten in den meisten Fällen anschließend allein mit ihrem unermesslichen Schmerz, ihrer Ohnmacht, ihrer Wut. In nicht wenigen Fällen begann das öffentliche Vergessen und Verdrängen sogar direkt nach der Tat, insbesondere dann, wenn die Getöteten kein soziales Umfeld hatten, das ein Erinnern einforderte.
Dem Vergessen und Verdrängen etwas entgegenzusetzen ist auch Ziel dieser Webseite. Die folgenden Materialien sollen zu einer Verständigung darüber beitragen, wie ein Erinnern und Gedenken aussehen soll und kann, das den Getöteten gerecht wird – und das dazu beiträgt, das derartige Verbrechen nie mehr geschehen.
weiterführende Informationen

Es wird geschwiegen bis es wieder passiert
Diskussion zum Gedenken an Todesopfer rechter Gewalt
Im April 2013 trafen sich Dieter aus Bernau, Julia aus Oranienburg, Ronny aus Brandenburg a.d.H.und Jan aus Neuruppin zu einem Gedankenaustausch über ihre Aktivitäten zum Gedenken an Todesopfer rechter Gewalt.
Das Interview führte Gabi Jaschke

Es wird geschwiegen bis es wieder passiert
Diskussion zum Gedenken an Todesopfer rechter Gewalt
- Dieter war Kreisjugendwart der Evangelischen Jugend Barnim und hat die Barnimer Kampagne Light me Amadeu mitgegründet.
- Julia vom Forum gegen Rassismus und rechte Gewalt Oranienburg setzte sich für einen Gedenkstein für Hans-Jochen Lommatzsch ein. Ob es bei der Tat auch politische Motive eine Rolle spielten ist heute nicht mehr zu klären.
- Ronny war aktiv in der Antifa Brandenburg a.d.H., die regelmäßige Gedenkveranstaltungen für den 1996 von Neonazis ermordeten 23-jährigen Punk Sven Beuter organisiert und ab 2012 erstmalig eine Gedenkkundgebung für Rolf Schulze in Lehnin druchführte.
- Jan organisierte sich im alternativen Jugendclub Mittendrin in Neuruppin. 2012 hatten die Jugendlichen eine Kampagne zum Gedenken an Emil Wendland initiiert.
Warum findet ihr es wichtig, Todesopfern rechter Gewalt zu gedenken?
Julia: Über das, was passiert ist, wird geschwiegen bis es wieder passiert. Deshalb ist es wichtig, dass es eine Aufarbeitung gibt. Wir wollen zeigen, dass hinter rechter Gewalt rechte Ideologie steht, dass rechte Ideologie die Hemmschwelle für Gewalt herabsetzt und dass diese Gewalt dann auch zum Tod führen kann.
Ronny: Leute haben die Vorstellung, dass Morde immer woanders passieren. Es gab aber eben auch in dieser Stadt jemanden, der von Nazis ermordet wurde. Das war vollkommen verdrängt. Man hat es einfach vergessen. Wir wollten das greifbar machen und dachten auch, dass dieser lokale Bezug ein Ansatzpunkt für Jugendliche ist, um sich mit Nazis zu beschäftigen. Dass die dann sagen: Und was machen die Nazis heute? Aber wir wollten auch zeigen: Rolf Schulze war nicht nur ein Obdachloser sondern ein Mensch, der eine eigene Geschichte hat, und die wollten wir erfahren.
Dieter: Vor allem finde ich es wichtig, um den alltäglichen Rassismus weiterhin zu bedenken. Denn der ist nicht weg.
Geht es euch eher um das Aufzeigen einer Kontinuität vom NS-Faschismus zu den jetzigen Nazis oder darum zu zeigen, dass die Mitte der Gesellschaft rassistisch oder sozialdarwinistisch handelt?
Jan: Naja, die Nazis, die in Brandenburg Morde begangen haben, sind ja nicht unbedingt ideologisch gefestigte Nazis. Sondern sie haben ihr Überlegenheitsgefühl ausgelebt, Menschen abgewertet und ihnen das Menschsein abgesprochen.
Ronny: Das muss man nach dem Einzelfall beurteilen. Die Mörder von Rolf Schulze z.B waren alle bei der Nationalistischen Front. Die waren in Wehrsportgruppen organisiert. Das waren durchaus gefestigte Nazis. Und Sascha Lücke, der 1996 Sven Beuter ermordet hat, ist seit 20 Jahren Neonazi und war auch damals schon organisiert.
Jan: Uns geht es auch um die Politik der Ausgrenzung. Wir sagen, die Nazis haben Emil Wendland auf Grundlage ihrer Ideologie ermordet. Aber die Legitimation dafür können sie aus dem Bestehenden ableiten. Sie können sich als Vollstrecker des Volkswillens zelebrieren. Wenn ein Mensch, der nicht arbeitet, als Sozialschmarotzer wahrgenommen wird, dann ist der Schritt, ihn umzubringen, in dieser Logik ja eigentlich nur konsequent. Uns geht es darum, diese Logik anzugreifen. Da den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen: Nee, mit Freiheit und Demokratie hat das nichts zu tun, wenn hier Häuser leer stehen, aber Menschen auf der Straße erfrieren.
Dieter: Menschenverachtung und Diskriminierung haben unterschiedliche Gesichter. Das muss nicht nur rassistisch sein, Menschenverachtung kann auch sozialdarwinistisch, homophob oder sonst wie ausgelebt werden. Die Leute, die damals zugeschlagen haben, egal wie betrunken oder ideologisch gefestigt sie waren, wollten Leute raus haben. Raus aus unserem Ort! Und letztendlich: Raus aus dem Leben! Die Erinnerung an Ausgrenzung, die bis zum Letzten ging, wollen wir weiter präsent halten in der Kommune. Wir wollen sagen: Ihr könnt tun, was ihr wollt! Die Diskussion wird nicht abebben bis nicht ein anderer Geist in unsere Städte und Dörfer kommt.
Ronny: Es geht darum, die Morde wieder in die Mitte der Gesellschaft zu tragen, über Neonazismus und Rassismus zu diskutieren und Konzepte dagegen zu entwickeln. Neonazistische Ideologie ist eine mordende Ideologie. Wir finden, dass man gegen diese Ideologie was machen kann und was machen muss. Bei Sven Beuter hat sich, seit 2007 eine Gedenkplatte verlegt wurde, die Stadt aus dem Gedenken zurückgezogen. 2011 hat der Bürgermeister gesagt, dass ein Gedenken eigentlich nicht mehr notwendig ist. Das ist der falsche Weg! Man darf diese Tat nicht vergessen und man darf nicht vergessen worauf Neonazismus und Rassismus letztendlich hinauslaufen.
Wie kommt es jetzt 15, 20 Jahre nach den Morden zu diesen neuen Impulsen für Gedenkaktivitäten?
Julia: Wir hatten die Ausstellung der Opferperspektive über Todesopfer rechter Gewalt zu uns geholt. Das war ein Anstoß, mehr zu recherchieren und das auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir kennen in Brandenburg namentlich etwa 30 Todesopfer rechter Gewalt. Anerkannt sind davon nur neun. Da muss man sich fragen, liegt hier auch ein Versagen der Behörden vor? Was ist mit den Opfern, die nicht anerkannt wurden? Man kann nicht sagen, das war damals, wir haben alles überwunden. Nein, die Probleme sind immer noch da. Sie wurden 1992/93 einfach unter den Teppich gekehrt.
Ronny: Bei Sven Beuter gab es ein kontinuierliches Gedenken in verschiedenen Wellen. Erst hat es die Antifa gemacht, weil die Leute, die damals in der Antifa waren, ihn auch persönlich kannten. Dann hat’s irgendwann die Partei Die Linke übernommen. Jetzt haben wir das wieder als Antifagruppe übernommen.
Und dass zu Rolf Schulze nichts passiert ist, liegt einfach daran, dass dieser Mord lange nicht präsent war. Das ist an vielen Leuten einfach vorbeigegangen. Tatort und sein ehemaliger Wohnort liegen 80 km voneinander entfernt und es gibt keine persönliche Beziehung der Lehniner zu Täter oder Opfer. Dann glaube ich, dass Rolf Schulze wegen seiner Obdachlosigkeit nicht so in der Gesellschaft verankert war und es dadurch keine Freunde gibt, die sich mit seinem Mord intensiv auseinandersetzen. Und was noch ein Problem ist, ist der Ort. Der Mord ist ja außerhalb von Lehnin an einem See im Wald passiert. Da kommt man nicht einfach so vorbei. Und so kann man das halt auch leicht verdrängen. Außerdem: An einen Ort wie Lehnin kommen viele Touristen. Da will man eigentlich mit so was nichts zu tun haben. Das war das Feedback, das wir von der Lehniner Bevölkerung erhalten haben.
Jan: Bei uns stand das im Kontext von 20 Jahre Lichtenhagen. Das war der Punkt zu sagen, was war denn damals vor 20 Jahren bei uns? Ich glaube, 20 Jahre, das ist symbolisch etwas, das dazu anregt, sich endlich mal darum zu kümmern. Aber wenn du fragst, warum nicht vorher? So etwas braucht auch immer erst mal ein bisschen Zeit.
In den 90ern wäre das nicht möglich gewesen. Da haben die Leute zugesehen, dass sie nicht selber umgebracht werden, ihre Häuser nicht angezündet werden. Da war auch das gesamtgesellschaftliche Klima noch viel ignoranter. Wir haben für die Recherche die Archive 1992 durchgeblättert. Da gab es auch noch ganz, ganz viele andere Fälle. Wirklich krasse Sachen. Brandanschläge gegen ein Spätaussiedlerheim, bei denen glücklicherweise niemand gestorben ist. Da war eigentlich wöchentlich was los in dieser Stadt. 100 bis 300 Nazis, die sich irgendwo sammeln und ein Haus angreifen oder vor einer Disko drohen: Wenn ihr die und die Leute nicht rausschickt, dann machen wir alles kaputt. Man hat immer von den Älteren gehört, wie schlimm es war. Aber sich noch mal deutlich zu machen, was da los war und was die Leute aushalten mussten, die sich dagegen gestellt haben! Da haben wir ja heute eher ruhige Zeiten. Ich glaube, dass ist auch ein Punkt, warum sich Leute jetzt mit Gedenken befassen können. Weil die direkte Bedrohung für Leute, die politisch aktiv sind, deutlich geringer geworden ist.
Dieter: Ich denke auch, dass es Zeit braucht, um Gedenken längerfristig zu verankern. Wobei – wie gesagt – das Gedenken an Amadeu Antonio in Eberswalde ja jedes Jahr stattfand. Ein Anlass für den Vorschlag zur Straßenumbenennung, den wir im April 2011 machten, war der 50. Geburtstag von Amadeu Antonio am 12. August 2012.
Habt ihr neben Gedenktafel und Straßenumbenennung auch andere Formen des Gedenkens diskutiert?
Jan: Das wurde nicht breit diskutiert. Es gibt ja die Initiative ‚Niemand ist vergessen‘. Das ist – wenn man selbstkritisch ist – leider nicht wahr. Denn es gibt ja viele, denen heute nicht gedacht wird. Aber es formuliert zumindest einen Anspruch. Eine Straßenumbenennung ist zumindest ein Garant dafür, dass der Mord für die nächsten Jahre nicht vergessen wird. Wenn du auf die Karte oder ins Internet guckst, siehst du den Namen und hast einen direkten Bezug dazu. Das ist von der Wahrnehmbarkeit her ziemlich gut. Aber: Wer fragt sich heute noch, wer das ist, wenn du so einen Straßennamen siehst? Das ist eigentlich ein bisschen wenig. Wenn du da so ’n Stein zum Gedenken hast, verhinderst du damit, dass sich so was wiederholt? Oder musst du andere Sachen machen? Ich glaube, ein reines Gedenken, wird so was nicht verhindern.
Ronny: Aber das steht doch immer in einem Kontext. Du kannst doch Gedenkpolitik nicht losgelöst von antifaschistischer Arbeit betrachten. Das greift ineinander.
Während andere um eine Gedenkplatte kämpfen, kämpft ihr in Eberswalde um die Umbenennung einer Straße. Wie kommt ihr darauf, plötzlich, nachdem es diese Gedenktafel schon gibt, eine Straße zu fordern?
Dieter: Die Gedenktafel war ja eine Initiative der Zivilgesellschaft. Die wurde dann auch erst mal von den Nazis beschmiert und zerstört und musste noch mal neu gemacht und richtig an einem Pfeiler eingelassen werden. Sie befindet sich an einer stark befahrenen Durchgangsstraße. Man nimmt sie kaum wahr, weil sie ein Teil des Zaunpfahls sein könnte. Ein Motiv für die Forderung nach Straßenumbenennung war auch der Gedanke, dass Straßen nicht nur A und B verbinden sondern eine Richtung weisen. Das war für uns symbolisch, die Amadeu-Antonio-Straße wäre auch im übertragenden Sinne wegweisend. Denn damit sagt man, dass die Vergangenheit zu dieser Stadt gehört. Wir meinten: Wenn Eberswalde einen ehrlichen und offenen Schritt zur Aufarbeitung tun will, dann sollte die Stadt auch mit einer offiziellen Geste diese Straße umbenennen. Nach einer zivilgesellschaftlichen Initiative, wäre das der Schritt zu einer offiziellen Anerkennung. Auch ein sichtbares Zeichen für die Verwandten, z.B. für seine Mutter und Geschwister in Angola, die lange Zeit nicht sichtbar waren und jetzt erst in dem Prozess zur Straßenumbenennung gedanklich reingeholt wurden.
Julia: Uns war es wichtig, gerade an diesem Ort, da, wo die Tat passiert ist, am ehemaligen Wohnort des Herrn Lommatzsch, einen Gedenkort zu schaffen, so dass man – ein bisschen ähnlich wie bei Stolpersteinen – wenn man vorbeigeht, drüber stolpert und sagt, aha hier ist also so was passiert! Das ist natürlich bei Fällen, wo jemand im Wald umgekommen ist, etwas schwieriger umzusetzen. Aber Straßenumbenennung war kein Thema.
Jan: Den Stolpersteinvergleich finde ich gar nicht so unpassend. Es geht darum, dass die Leute realisieren, dass das nicht etwas ist, dass ganz weit außen passiert, womit man nichts zu tun hat, sondern da, wo man selber wohnt, da ist es passiert.
Dieter: Ich wollte noch eine Sache nachtragen, weshalb wir die Straßenumbennenung vorgeschlagen haben: Es gab ja auch zur DDR Zeit schon Schwarze, die erschlagen wurden. Und in diesem Abschnitt der Eberswalder Straße, den wir umbenennen wollen, da befanden sich auch die Wohnheime der Vertragsarbeiter. Die waren ja – ähnlich wie heute viele Flüchtlinge – in Heimen untergebracht, mit möglichst wenig Kontakt zur Bevölkerung. Auch dadurch sind die Ressentiments gestiegen. Das wollten wir mit dem Vorschlag verbinden, also den Tatort und den Ort der strukturellen Ausgrenzung.
Gab es auch Überlegungen zu anderen Formen des Gedenkens?
Ronny: Nicht wirklich. Eine Kundgebung, auf der man dann letztendlich jahrelang dasselbe erzählt, reizt irgendwann keinen mehr. Wir haben dieses Jahr versucht, über einen Gedenkspaziergang ein bisschen mehr draus zu machen. Aber ich habe keine Antwort. Man braucht sich ja nur das Gedenken an Silvio Meyer angucken. Naja gut mit der Umbenennung der Straße passiert jetzt was. Aber ansonsten? Selbstfeierung der linken Szene.
In Lehnin gab es die Idee, Schüler anlässlich des Gedenktages zum Thema Rechtsextremismus oder zum Thema Sozialdarwinismus recherchieren zu lassen, als eine andere Form von Auseinandersetzung.
Ronny: Ja, das steht auch immer noch im Raum. Da war ja eine Lehrerin mit ihren Schülern da. Ich glaube, das ist ein wichtiger, richtiger Weg, um junge Leute mit der Geschichte ihres Dorfes, ihres Wohnortes in Kontakt zu bringen.
Was habt ihr, Dieter, als älteste Initiative am Tisch denn diskutiert, wie sich Erinnerung wachhalten lässt?
Dieter: In der Vorbereitung wurde uns klar: Wer schlimme Entwicklungen und Taten verdrängt, sie nicht wahrnimmt, fühlt sich auch nicht verpflichtet, etwas zu ändern. Darum arbeiten wir für deren Wahrnehmung und für die Verknüpfung mit unserer Gegenwart. Wir kennen in Eberswalde beispielsweise einen Schwarzen Deutschen, der das KZ überlebt und ein Buch darüber geschrieben hat. Ihn baten wir um eine kurze Lesung beim Gedenken im letzten Jahr. Aber er konnte dann aus gesundheitlichen Gründen nicht. Wir nehmen immer wieder Elemente mit rein, an denen deutlich wird, dass Rassismus nicht bloß vor 20 Jahren sondern auch vor 150 Jahren ein Problem war und immer noch ist. Um diese Kontinuität, die sowohl die DDR, als auch die BRD überdauerte, deutlich zu machen. Wir nennen das „Zeugnisse der Betroffenheit“. Das knüpft an den Prozess an, der in den DDR-Kirchen 1987-1989 gelaufen ist, der „Konziliare Prozess für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung“. Da spielten „Zeugnisse der Betroffenheit“ eine wichtige Rolle, weil da Leute auftraten, die gesagt haben, was uns in dieser DDR und auch weltweit, also nicht bloß als DDR Opposition, nervt.
Es gibt ja schon seit Jahren die Diskussion um die Anzahl der Todesopfer rechter Gewalt. Das Brandenburger Innenministerium hat jetzt als Konsequenz von den NSU Morden angekündigt, alte Fälle aufzuarbeiten und sich die alten Akten noch mal vorzunehmen. Das Moses-Mendelssohn-Zentrum wurde mit der Prüfung betraut. Welche Rolle spielt es für euch, ob die Getöteten als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt werden?
Jan: Wir haben das offensiv angegriffen. Wir haben gesagt, das ist Propaganda, die dafür da ist, zu verharmlosen. Darauf legen wir keinen Wert. Wir haben nicht das Ziel, beim Staat darum zu betteln, dass er Opfer rechter Gewalt anerkennt. Diese Anerkennung hilft niemandem. Was mit dieser Statistik an Politik gemacht wird, ist widerlich. Allein, dass Leute, je nachdem wie die Regierung gerade drauf ist, von den Listen gestrichen werden oder nicht, das ist schäbig. Wir sagen, ihr seid sowieso ein Teil des Problems, weil ihr verharmlost.
Ronny: Ich sehe das anders. Es geht nicht darum, den Staat anzubetteln, sondern ihn dazu zu kriegen diese Morde anzuerkennen, um ein Argument zu haben, dass der Staat was tun muss.
Julia: Als wir die Initiative gestartet haben, gab es diese Überprüfung noch nicht. Und das war auch eines der Ziele, die wir erreichen wollten, dass die Fälle, die wir nachrecherchieren, auch in der Statistik auftauchen. Für uns war immer klar, durch das Auftauchen in der Statistik, auch wenn es vielleicht missbraucht wird, gibt man den Opfern ein Gesicht. Und das wollen wir erreichen. Zum anderen – da stimme ich vollkommen zu – muss man auch dem Staat sein Versagen klar vor Augen führen, um Argumente dafür zu haben, das er sich mit Neonazismus und weiteren Diskriminierungsformen auseinandersetzt. Aber ich frage mich auch, was bei so einer Untersuchung rauskommen soll, wenn vielleicht in den Akten steht, es waren keine Neonazis, weil in den 90er Jahren so was überhaupt nicht berücksichtigt wurde, sondern gesagt wurde, wir haben ja keine Neonazis hier. Was dann? Was passiert, wenn die Opfer dann immer noch nicht anerkannt werden?
Dieter: Ich finde den Kampf um die Anerkennung wichtig. Aber er verschleiert auch viele Fälle, die im Graubereich liegen. Es gibt viele nicht-angezeigte rechte Straftaten, die keine Tötungsdelikte sind, aber bei denen Leute zu Schaden gekommen sind. In Eberswalde sind beispielsweise auch weiße Frauen von Schwarzen, z.T. in ihren Wohnungen, attackiert worden. Eine Frau ist mit einer Axt auf offener Straße angegriffen worden. Das sind alles Sachen, die in keiner Statistik auftauchen. Ich bin einerseits froh, dass es greifbare Zahlen gibt. Denn so kann man sagen: „Das ist kein Randphänomen!“ Das sind nicht bloß 10 Leute, sondern es ist eine erheblich Anzahl. Aber auf der anderen Seite, konzentriert man sich dann nur auf die Todesopfer und verdeckt damit vielleicht auch was.
Jan: Wann immer man von Opfern rechter Gewalt spricht, wird niemals die Statistik der Bundesregierung herangezogen, sondern immer die Recherchen vom Tagesspiegel und anderen Zeitungen. Allein die Diskrepanz! Es handelt sich ja nicht um 2 Morde sondern um über 100! Das ist für mich ein Brandmal. Ich appelliere da nicht an den Staat und sage: Löst den Rassismus. Das werden die nicht von sich aus machen. Das müssen wir denen abringen. Von daher sehe ich keinen Sinn in so einer Bitte an den Staat.
Julia: Das ist keine Bitte an den Staat. Nein, das ist eine Notwendigkeit.
Dieter: Noch wichtiger als eine staatliche Statistik finde ich, dass es ein System gibt, wie die ermittelnden Behörden damit umgehen, wenn sie naheliegende Indizien haben, dass da was Rechtes oder Rassistisches passiert ist. Es gibt ja kein System, wer dann informiert wird. Im besten Fall findet die Opferperspektive in irgendeinem Bericht etwas und fragt noch mal nach. Ich kann dazu ein konkretes Beispiel nennen: Einen Tag vor Weihnachten 2011 gab es in Eberswalde eine rassistisch motivierte Körperverletzung. Die wurde erst Monate später bekannt. Dann haben wir drei Mal beim Bürgermeister vor Ort nachgefragt, was da gewesen ist. Er wusste davon nichts, hatte diese Meldung nicht gekriegt. Drei Nachfragen bis dann im September eine auch nur halb klare Antwort kam. Das ist kein System! Ein System wäre, wenn zumindest der Bürgermeister oder am besten auch jemand von der Zivilgesellschaft informiert würde, dass da jemand angegriffen worden ist. Vielleicht traf es ja Menschen aus dem Ort und man kann sich um sie kümmern?
Das vollständige Interview ist erschienen im Buch der Opferperspektive (Hrsg.): „Rassistische Diskriminierung und rechte Gewalt. An der Seite der Betroffenen beraten, informieren, intervenieren“. Verlag Westfälisches Dampfboot, 19,90 €, ISBN: 978-3-89691-947-2

Aufstand der Trauer
ManyPod, den Podcast für die Gesellschaft der Vielen. Folge 8
Gespräch mit Miriam Schickler und Ulf Aminde über historische und aktuelle Formen des Erinnerns von Betroffenen von rassistischer und antisemitischer Gewalt und darüber, dass Aufforderungen wie #saytheirnames der Initiative 19. Februar Hanau und «Reclaim & Remember» von Ibrahim Arslan, nicht nur die Opfer dem Vergessen entreißen, sondern für eine andere Gesellschaft kämpfen, in der solche Taten nicht mehr möglich sind.
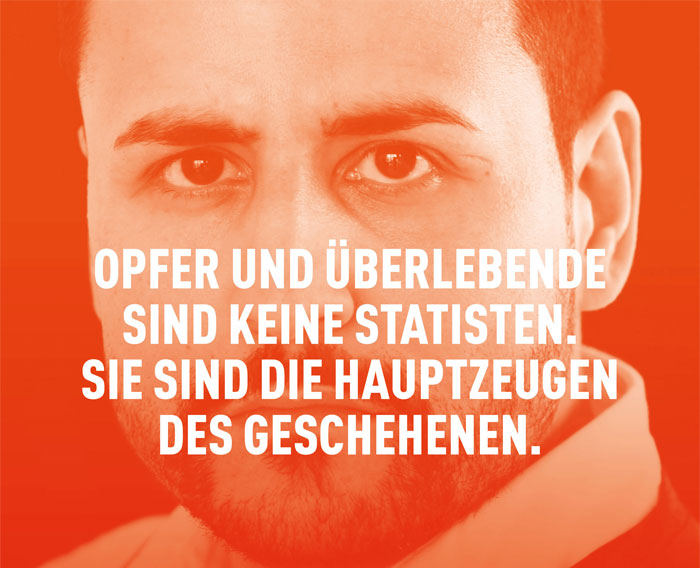
Von Mölln bis nach Hanau: Erinnern heißt verändern
Newroz Duman, İbrahim Arslan,
Eine würdige Erinnerungskultur muss die Kontinuität rechter Gewalt in den Blick nehmen und Konsequenzen ziehen. Eine Denkschrift über die Praxis des Erinnerns als Mahnung zur Veränderung und über die Erfahrungen der migrantischen Selbstorganisation
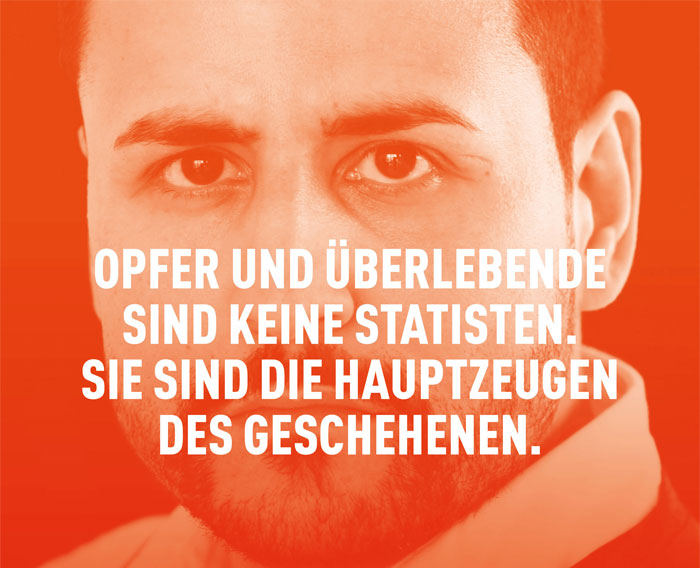
Von Mölln bis nach Hanau: Erinnern heißt verändern
Eine würdige Erinnerungskultur muss die Kontinuität rechter Gewalt in den Blick nehmen und Konsequenzen ziehen. Eine Denkschrift über die Praxis des Erinnerns als Mahnung zur Veränderung und über die Erfahrungen der migrantischen Selbstorganisation von Newroz Duman, Aktivistin der Initiative 19. Februar in Hanau und İbrahim Arslan, Aktivist und Überlebender der rassistischen Brandanschläge von Mölln 1992.
19. Februar 2021
Von Newroz Duman und İbrahim Arslan
Es darf kein Vergessen geben! Ein einfacher Satz. Es ist ein Satz, der uns verbindet. Hinter seiner Einfachheit verbergen sich die Geschichten und Erfahrungen Unzähliger. Er ist die Lösung antifaschistischer Kämpfe, die eine Linie der Kontinuität aufzeigt, die von Hanau im Jahr 2020, nach Mölln im Jahr 1992, bis hin zur nationalsozialistischen Gewalt der 1930er und 1940er Jahre reicht. Dieser Satz ist nicht nur das verbindende Element unserer Kämpfe, er ist auch die Bedingung für ein würdiges Erinnern. Ein würdiges Erinnern, das wir gewillt sind zu erkämpfen. Die Erinnerung an das Geschehene, an das Vergessene, an das stets Verschwiegene, an die Ursachen und die Folgen, an das Davor und Danach zu nähren, zu pflegen, zu bewahren. Diese Erinnerung muss zur Erinnerung aller werden. Denn sie mahnen uns, sie lehren uns, sie leiten uns. Diese Forderungen sind aktueller denn je. Es gibt eine Kontinuität rechter Gewalt in diesem Land, die es genauso zu benennen gilt, wie die Kontinuität, wie wir mit Betroffenen und Angehörigen umgehen.
Dieser einfache Satz verpflichtet uns: Es darf kein Vergessen geben! Zur Übernahme direkter Verantwortung und ständiger Arbeit. Dieser Arbeit, der wir unfreiwillig ausgesetzt sind, zu der wir durch die rassistischen Verhältnisse verurteilt wurden, ist vielschichtig und herausfordernd. Neben der direkten Hilfe für und Stabilisierung von Opfern und Angehörigen, neben der sozialen Wiedereingliederung, neben dem Strafprozess gegen die Täter:innen, neben den unermüdlichen Kämpfen um Aufklärung der rechten Morde und der Anerkennung und Benennung der rechtsterroristischen Gewalt, steht auch die Dimension der Erinnerung als politische Praxis. Ein Teil dieser Erinnerungspraxis ist die Sichtbarmachung der Namen und Geschichten der Opfer, der Angehörigen und der Überlebenden. Sie müssen gesehen, müssen gelernt und gelehrt werden. Say their names!
Was heißt in Würde gedenken? Wie sprechen wir heute nach zwei Jahrzehnten Betroffenenarbeit und Selbstorganisierung von Migrant:innen und Betroffenen rechter rassistischer Gewalt über Solidarität und Rassismus? Es sind Fragen, die uns alltäglich im Zuge unserer Arbeit begleiten und nicht loslassen. Spätestens seit dem rassistischen Terroranschlag in Hanau stellen wir uns zusätzlich gemeinsam die Frage nach der Weiterentwicklung, des gegenseitigen Bestärkens und aufeinander Beziehens dieser Kämpfe. Die folgenden Seiten sind der Versuch, diese Verschränkung erstmals in Worte zu fassen. Denn ohne Erinnern kein Verändern. Die Kämpfe der Angehörigen der am 19. Februar in Hanau Ermordeten sind ohne diesen Zweiklang nicht zu verstehen; sie stehen in einer Linie der vielen vorangegangenen Jahre an Kämpfen Angehöriger und Opfer rechten und rassistischen Terrors in Deutschland.
In den 1980er–1990er Jahren gab es für Angehörige nicht einmal ansatzweise eine ähnliche Solidarität und Hilfen wie es sie heute gibt, es waren meist Einzelpersonen, die sich Interventionen von Betroffenen anschlossen. Es gab weder Opferverbände, noch Initiativen, die Betroffene stabilisierend unterstützen konnten. Die Betroffenen waren meist ihren eigenen Schicksalen ausgesetzt. An einzelnen Fällen wie beispielsweise bei der Familie Arslan kann man eindeutig erkennen, wie schwer es war, die grundlegenden Elemente wie psychische Behandlung, Stabilisierung oder Solidarität sowie eine erträgliche Gedenkkultur zu gewährleisten, um den Zustand zu verbessern. Stattdessen mussten die Familien einen erheblichen Kampf der Bürokratie gegen Institutionen führen. Auch an diesen Zuständen hat sich bis heute leider kaum etwas verändert, es ist nur durch Verbände und NGO’s erträglicher geworden, es auszuhalten.
Say Their Names!
Am 20. Februar, einen Tag nach dem Anschlag in Hanau, standen Bundespräsident Steinmeier, der hessische Ministerpräsident Bouffier und der Hanauer Oberbürgermeister Kaminsky gemeinsam auf einer Bühne auf dem Marktplatz, um irgendwie angemessene Worte dafür zu finden, was kurz zuvor passiert war. Während die politischen Repräsentant:innen sich inszenierten, wurde den Opfern nicht einmal eine zweitrangige Bedeutung zugesprochen. Sie wurden schlichtweg ausgeschlossen, waren nicht präsent, nicht einmal in Form einer Schweigeminute.
Am 21. Februar, 48 Stunden nach den Morden, wurden dann zum ersten Mal die Namen der Ermordeten öffentlich gesagt. Sie wurden erstmals öffentlich und zusammen ausgesprochen; sie wurden geschrien, mit Tränen, Trauer und Wut. Von Freund:innen, mit der Familie, inmitten von Überlebenden. Und Journalist:innen vermittelten die Bilder in alle Welt.
Wir erinnern uns an die Morde des NSU, bei denen es noch Jahre nach der Selbstenttarnung des Nationalsozialistischen Untergrunds und den Gerichtsprozessen um die Gesichter und Namen der Täter:innen ging und immer sie im Vordergrund standen. Zumindest haben wir es heute, zusammen mit Angehörigen und Betroffenen, geschafft diese Forderung, ihre Namen zu nennen, für die Opfer umzusetzen.
Schließlich, es war der 22. Februar, fand ein zweites Gedenken statt. Dieses Mal waren nicht nur die neun Ermordeten unter uns präsent. Die Bühne der bundesweiten Demonstration gehörte den Angehörigen, den Freundeskreisen und den Initiativen der unzähligen weiteren rassistischen Anschläge der Jahre zuvor.
Am 4. März, bei der zentralen offiziellen Trauerfeier, zeigte sich dann, dass auch an den politischen Verantwortlichen die Tage zuvor nicht spurlos vorbeigegangen waren. Alle Reden begannen mit den Namen der Opfer und die Angehörigen waren mehr als nur Statist:innen, sie waren die Hauptzeug:innen des Geschehenen.
Ein entscheidendes und stets präsentes Element unserer Demonstrationen, Kundgebungen und Veranstaltungen sind die Portraits der Opfer. Die Bilder, das war von Beginn an klar, sollten nur nach Wunsch der Betroffenen verwendet werden. Das gilt auch heute noch. Wenn wir gedenken, stellen wir uns immer wieder die Fragen: Welche Bilder dürfen wir benutzen? Welche Bilder müssen gezeigt werden? Welche Bilder sollten damals gezeigt werden und heute nicht mehr? Welche Bilder sollten damals nicht gezeigt werden, können es aber heute?
Später dann wurden T-Shirts mit den Abbildungen der Ermordeten gedruckt, ergänzt mit dem Schriftzug „saytheirnames“. Vor allem für junge Leute sind die T-Shirts sehr wichtig. An die 1.500 Stück haben wir gedruckt und verteilt. In den warmen Sommermonaten tauchten sie, zusammen mit den Aufklebern, überall im Hanauer Stadtbild auf. Mit dem fortschreitenden Trauerprozess verlieren sie nun langsam an Bedeutung. Die Namen jedoch, sie bleiben weiterhin fester Bestandteil des Stadtbildes – während sie zeitgleich, und sogar als Wandbilder, in vielen anderen Städten Deutschlands ebenfalls auftreten.
Es gibt sehr große Unterschiede zwischen solidarischem Gedenken und Gedenken für Imagepolitik, das hat zum Beispiel die Erfahrung im Gedenken an den rassistischen Brandanschlag in Mölln bis heute gezeigt. Wir möchten nicht, dass irgendjemand aus unserem Leid einen Profit zieht. Wir sind die Hauptzeug:innen des Geschehenen, wir sind die Opfer und Betroffenen, wir sind die Expert:innen und keine Statist:innen. Dementsprechend bleibt die wichtigste Voraussetzung dafür, dass saytheirnames empowernd wirken kann, dass zu jeder Zeit immer und immer wieder darüber kommuniziert wird, was als angemessen und würdig empfunden wird. Die Erfahrungen aus Mölln, des Tribunals NSU-Komplex auflösen und der vielen anderen Kämpfe zuvor haben eine wichtige Rolle in diesem Prozess gespielt.
Gedenkorte: Erinnern als Mahnung zur Veränderung
Seit geraumer Zeit betonen Angehörige und Opfer die Wichtigkeit, Orte des Sprechens über rassistische Gewalterfahrungen, das dazugehörige Gedenken und eine kritische Auseinandersetzung damit zu schaffen. Erst, wenn Betroffene ihre Geschichten erzählen, ihnen zugehört wird und wir uns darüber austauschen, was Ungerechtigkeit ist und wie Gerechtigkeit aussehen kann, können wir auch die Spielregeln dieser Gesellschaft und gegenwärtigen Erzählungen verändern.
In Hanau waren dafür die beiden Tatorte und das Brüder-Grimm-Denkmal am Marktplatz als Orte des Gedenkens von unschätzbarer Bedeutung. Vom ersten Tag an haben sie sich zu Gedenkorten entwickelt. Überlebende, Freund:innen, Angehörige fanden hier ihren Ort. Und neben ihnen kamen auch viele Menschen, die in dieser Stadt oder woanders leben, hierher, haben ihre Trauer ausgedrückt und Nachrichten hinterlassen. Sehr früh schon stand am ersten Tatort ein Blumenkorb mit Grüßen aus dem Kiezdöner in Halle, wo im Oktober 2019 ein rechtsterroristisches Attentat stattfand. An den drei Gedenkorten fanden viele zufällige Begegnungen zwischen Menschen statt, die sich in ihrer Trauer und mit ihren offenen Fragen dort trafen.
Alle drei Orte wurden gepflegt. Anfangs wurden die Blumen zweimal pro Woche gepflegt und erneuert. Die Midnight-Bar, einer der Tatorte, öffnete im Juni mit einem neuen Besitzer, der fragte, was mit all den Blumen und Zeichen des Gedenkens vor der Tür gemacht werden soll. Seitdem trägt eine Gedenktafel rund um den Baum vor der Bar die Fotos und Namen der Ermordeten, Blumen und Kerzen. Am 19. Juli wurde auch in Hanau-Kesselstadt eine Gedenktafel und gepflanzte Blumen gemeinsam von Angehörigen und Unterstützer:innen hergerichtet.
Erinnern und sichtbar halten verändert nachhaltig die Stadtgesellschaft und fordert zur Auseinandersetzung auf. Während wir permanent mit dem Gedenken beschäftigt waren, wollten manch andere bereits zum Vergessen übergehen. Es war Ende Juli, keine sechs Monate nach dem Anschlag, als der CDU-Politiker Kasseckert forderte, Hanau müsse “zur Normalität zurückkehren”. Man müsse langsam darüber nachdenken, die Informationen und Gedenktafeln zum rassistischen Anschlag abzubauen und woanders aufzubauen. Beispielsweise am städtischen Zentralfriedhof. Für uns war dies keine verwunderliche Reaktion einer weißen, privilegierten und von Rassismus nicht betroffenen Person. Doch die Reaktion der Familien kam prompt und sie war klar: Erinnerung gehört nicht auf den Friedhof, sondern ins Zentrum der Stadt. Erinnern dient mehr als nur der Trauerbewältigung, sie gilt auch als Mahnung zur Veränderung.
In dieser Debatte zeigte sich einmal mehr, dass das öffentliche Erinnern stört, weil es den rassistischen Normalzustand stört. Zugleich sind wir heute sicher weiter als die vielen anderen Familien, die über Jahre um Anerkennung kämpfen mussten.
Eine der Opferfamilien schaffte es erst nach monatelangem Kampf, eine zunächst sehr zurückhaltende Dietzenbacher Stadtverordnetensitzung von der Notwendigkeit eines Ehrengrabs sowie einer Gedenkstelle auf einem zentralen Platz inmitten der Stadt zu überzeugen. Zugleich war im rumänischen Singureni und im bulgarischen Mezdra, den Geburtsorten von zwei Ermordeten, die Notwendigkeit eines zentralen Gedenkortes für alle Opfer des 19. Februar ein weitaus weniger strittiges Thema. Als Angehörige mit den jeweiligen Bürgermeistern in Kontakt traten, konnten sie schnell und unbürokratisch Gedenkorte einrichten. Inzwischen zeigt der Umgang mit der Entwicklung der Gedenkorte seitens der Stadt Hanau deutlich, dass die Angehörigen selbst bestimmen können, wie diese auszusehen haben.
Zusammenkommen: Erinnern wird Veränderung
Die fortwährende Mahnung und die Kämpfe vieler Angehöriger um die Anerkennung ihrer Stimmen im Prozess des Gedenkens und die daraus entstandenen Erfahrungen haben auch das Vorgehen der Initiative 19. Februar in Hanau mitbestimmt. Das Zusammenkommen und die starke Selbstorganisierung, wie wir sie hier erleben, wäre ohne diese Erfahrungen nicht möglich gewesen.
Am 19. März 2020 kamen zum ersten Mal viele der Hanauer Familien in Kesselstadt zusammen. Direkt zu Beginn des Corona-bedingten Lockdowns entstand zum ersten Mal ein gemeinsamer Ausdruck des Gedenkens. Vor der Verlesung eines Erinnerungstextes fragten wir zuerst alle Familien, ob wir ihn in dieser Form verlesen dürfen, ob sie etwas daran ergänzen oder korrigieren möchten. Diesen Umgang behalten wir weiterhin bei.
Kurz darauf entstand der Laden der Initiative 19. Februar. Ein Laden als Ort der permanenten Erinnerung, der Solidarität und der Selbstorganisierung. Hier wird Erinnerung Veränderung. Wir leben diesen Prozess gemeinsam, Tag für Tag. Zentral im Raum ist ein Gedenkplatz eingerichtet, er erinnert an die Verstorbenen und bestimmt unser Handeln mit. Wir eröffneten einen Raum der Solidarität, Trauer, Wut und Selbstorganisierung. Die Erfahrung derjenigen, die sich seit Jahren in vielen vorangegangenen Kämpfen gegen Rassismus und für die Gesellschaft der Vielen einsetzen, ist hierfür sehr entscheidend gewesen.
Durch das Erinnern wurden auch starke Verbindungen zu anderen Orten geschaffen. Betroffene und Aktive aus der Keuppstraße in Köln, aus Mölln und aus Halle bestimmten mit ihrer Solidarität und ihrem Wunsch, die Kämpfe miteinander zu verbinden, den Selbstorganisierungsprozess in Hanau mit. Darüber hinaus spüren wir die starke Solidarität vieler weiterer Initiativen, die sich gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt tagtäglich einsetzen. Ein ständiger Prozess der Vernetzung, der Erinnerung, der Politisierung und der Selbstorganisierung, im Versuch, den gesellschaftlichen Diskurs damit zu beeinflussen.
Entscheidend dabei ist stets, partizipative antirassistische Projekte zu organisieren und dauerhafte Räume und Strukturen zu schaffen und Betroffene daran zu beteiligen. Die Mehrheitsgesellschaft muss lernen, sich zu positionieren und den Täter:innen keine Bühne zu bieten. Worauf es ankommt, ist ein Perspektivenwechsel, hin zu den Opfern und Betroffenen – damit Opfer rechter Gewalt nicht mehr als reine Objekte, sondern als handlungsmächtige Subjekte anerkennt werden. Es gibt viele Erfahrungen und Geschichten, viele Verletzungen, viele Wünsche und Bedürfnisse. Es gilt, ihnen zuzuhören, sie aus der Vereinzelung herauszuholen und zu vernetzen, um so neue Erinnerungspolitiken herauszufordern.
Der 22. August war in diesem Sinne ein extrem wichtiger gemeinsamer Moment. Auf der Bühne standen Eltern, Geschwister, Freund:innen und Überlebende gemeinsam. Sie hatten sich innerhalb von fünf Wochen auf eine bundesweit mobilisierte Großdemonstration vorbereitet, vier Kernforderungen entwickelt und ihre Reden vorbereitet. Weniger als 20 Stunden vor dem Start kam dann das Verbot der Stadt für die Demonstration, begründet mit den gestiegenen Corona-Infektionen. Über Nacht gelang es der Initiative einen Live-Stream zu organisieren, bundesweite Strukturen veränderten ihre Pläne und meldeten an vielen Orten Kundgebungen an, statt in Busse nach Hanau zu steigen. Trotz des Verbots war Hanau mit den starken Stimmen an diesem Tag dennoch überall zu hören.
Erinnern heißt kämpfen. Die Frage nach den Konsequenzen
Werden Betroffene instrumentalisiert und mundtot gemacht? Können institutionelle Gedenkveranstaltungen überhaupt authentisch sein oder haben nicht eigentlich die Betroffenen über das Gedenken zu bestimmen? Diese Fragen bleiben weiterhin zentral, aber mit Hanau sind wir auf dieser Ebene einen Schritt weitergekommen.
Den Angehörigen, Überlebenden und Unterstützer:innen ist es gelungen, durch Erinnerung und Gedenken auch den öffentlichen Diskurs mitzubestimmen. Zum ersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte fingen Medienberichte mit den Namen der Opfer an. Sehr früh wendeten sich alle Familien mit ihren jeweiligen Forderungen an die Öffentlichkeit und an die politischen Entscheidungsträger:innen. Das ist einmalig.
Der öffentliche Diskurs wird endlich durch die Angehörigen bestimmt. Mit der Erinnerung kämpfen sie auch um die anderen Forderungen, wie nach sozialer Gerechtigkeit, lückenloser Aufklärung und Konsequenzen. Ein Kampf, der durch Wut und Trauer bestimmt ist und in die Entschlossenheit mündet, gemeinsam weiter zu machen: “Wenn wir nicht darum kämpfen, gibt es keine Aufklärung und Konsequenzen. Wenn wir nicht kämpfen, dann wird vergessen.”
Andererseits ist es eine Schande und Ungerechtigkeit, dass ausgerechnet Angehörige, Opfer und Betroffene Monate oder jahrelang tagtäglich für Aufklärung und angemessenes Gedenken kämpfen müssen. Es ist die Pflicht eines Staates und der Gesellschaft, Verantwortung zu tragen. Schließlich gedenken wir nicht nur, um uns mit den Familien und Betroffenen zu solidarisieren, sondern weil Rassismus ein gesamtgesellschaftliches politisches Problem ist, das uns alle etwas angeht. Das Ende des Rassismus ist nur durch kollektive antirassistische Anstrengungen zu erreichen.
Wenn nach Hanau die politischen Entscheidungsträger:innen nicht aus den Fehlern der Vergangenheit lernen möchten, wenn Politik und Mehrheitsgesellschaft den Rassismus und die rechte Hetze im Parlament und in den Medien weiterhin relativieren, heißt das heute immer noch, dass alles, was sich bisher bewegt hat, nicht selbstverständlich ist, sondern erkämpft werden musste. Und so geht es immer weiter.
Betroffene werden zu Aktivist:innen, die als Hauptzeug:innen Wissen haben, das sie effektiv einzusetzen wissen. Ein Wissen, das nicht nur zur Verteidigung der Opfer dient, sondern auch zugunsten einer antirassistischen, antifaschistischen, demokratischen Verteidigung der Gesellschaft. Auch wenn wir Opfer sind, auch wenn wir Repression ausgesetzt sind, wissen wir doch sehr wohl, wie es ist, ohne Staatsbürgerschaft, ohne gleiche Rechte, ohne Gleichberechtigung, ohne Anerkennung von der Mehrheitsgesellschaft. Wie es ist, uns nicht zu beugen, uns selbst zu organisieren und zu kämpfen.
Wenn wir in Zukunft über Rassismus und professionelle und solidarische Betroffenenberatung sprechen, muss das auf partnerschaftliche Augenhöhe und entlang einer radikalen Partizipation mit den Betroffenen passieren. Partnerschaftliche Solidarität ist das, wie wir zusammen kämpfen und uns zusammen organisieren möchten.
Mit unseren Kämpfen der vergangenen Jahrzehnte, mit unserem Widerstand und unserer aufbauenden ermutigenden Arbeit, konnten wir weitere Betroffene davon überzeugen, gegen die Gedenkkultur der Behörden, die die Opfer allein als passive Menschen behandeln, aktiv aufzustehen und sich zu wehren. Trotz des Fortlebens der terroristischen Rechten, die nicht aufhört, immer mehr Menschen aus unserer Mitte und unseren Herzen zu reißen, mobilisierten und organisierten wir betroffene Familien. Trotz all dessen und noch viel mehr, haben sich die Betroffenen nicht unterkriegen lassen und es werden mehr und mehr solidarische tragfähige Strukturen erkämpft. Mittlerweile sprechen sie in der Öffentlichkeit, führen Veranstaltungen durch, schreiben Bücher, machen Filme, entwickeln Theaterstücke, sind in Schulen, gehen auf Demonstrationen und halten Reden auf Kundgebungen. Kurzum, sie sind aktive und handlungsfähige Menschen, die entscheidenden Widerstand gegen Rassismus und Faschismus leisten.
Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen. Vier Forderungen, die nicht erst seit dem 19. Februar 2020 gelten. Es sind auch die Forderungen all der Kämpfe, die zuvor begannen und noch immer geführt werden. Dank der Selbstorganisierung der Hanauer Familien, Angehörigen und Freund*innen sind sie hörbarer geworden.
Links:
Freundeskreis im Gedenken an die rassistischen Brandanschläge von Mölln 1992
Initiative 19. Februar Hanau
Der Artikel ist erstmals bei Heimatkunde, dem Migrationspolitisches Portal der Heinrich-Böll-Stiftung erschienen. Wir bedanken uns bei den Autor:innen für die Möglichkeit den Artikel zu veröffentlichen.
 Es werden von YouTube keine Informationen über die Besucher auf der Website gespeichert, es sei denn, sie sehen sich das Video an.
Es werden von YouTube keine Informationen über die Besucher auf der Website gespeichert, es sei denn, sie sehen sich das Video an. Möllner Rede im Exil
Die Angehörigen und Überlebenden des rassistischen Brandanschlag 1992 in Möllns setzen sich seit vielen Jahren für ein selbstbestimmtes Gedenken von Betroffenen und Überlebenden ein. Ein Bestandteil dessen ist die „Möllner Rede im Exil“. Sie ist immer eine kritische Bestandsaufnahme zum gesellschaftlichen Rassismus, Neonazismus und Umgang mit Gedenken. Veranstaltung 7.1.2021 im Schauspielhaus Kiel

Warum erinnern?
Zissi Sauermann
Während heute tödliche rechte Gewalt immer wieder zu „tragischen Einzelfällen“ uminterpretiert wird, werden der gesamtgesellschaftliche Rassismus oder die Marginalisierung gesellschaftlicher Minderheiten ausgeblendet. In diesem Spannungsfeld bewegt sich das Gedenken und Erinnern an Todesopfer rechter Gewalt nach 1945 und bis heute.

Warum erinnern?
In Deutschland musste Gedenken an Opfer rechter Gewalt vielfach erkämpft werden. Und auch wenn das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus heute selbstverständlich zu sein scheint, war das nicht immer so. Dort, wo heute KZ-Gedenkstätten sind, befanden sich zum Teil noch vor zehn Jahren Gefängnisse, Supermärkte oder Betriebe. Überlebende, Angehörige und ihre Unterstützer*innen haben diese Gedenkorte der deutschen Gesellschaft abgerungen. Parallel ist zu beobachten, dass sich unter anderem Politiker*innen das Gedenken beispielsweise für die Imagepflege ihrer Region oder des Standorts Deutschland zu vereinnahmen versuchen.
Und während heute tödliche rechte Gewalt immer wieder zu „tragischen Einzelfällen“ uminterpretiert wird, die mit der historisch geläuterten Gesellschaft nichts zu tun hätten, werden der gesamtgesellschaftliche Rassismus oder die Marginalisierung gesellschaftlicher Minderheiten ausgeblendet. In diesem Spannungsfeld bewegt sich das Gedenken und Erinnern an Todesopfer rechter Gewalt nach 1945 und bis heute.
Entpolitisierung und Entkontextualisierung rechter Gewalt
So wie es eine gerade in jüngster Zeit dramatisch sichtbar werdende Kontinuität des rechten Denkens und Handelns in Deutschland gibt2, so gibt es auch bedenkliche Kontinuitäten des gesellschaftlichen, politischen und justiziellen Umgangs mit den Taten, Opfern und Betroffenen rechter Gewalt. Sie reichen von einer Verharmlosung und Entpolitisierung, Schuldabwehr, Kriminalisierung und Täter-Opfer-Umkehr bis hin zu einer unzureichender Strafverfolgung. So wird nach rechten Gewalttaten gern besonders betont, wenn Täter*innen nicht aus dem Ort kommen3. Denn noch viel zu oft stehen statt Empathie und Solidarität mit Hinterbliebenen und Betroffenen Standortlogiken im Vordergrund. Politisch Verantwortliche klagen immer wieder über eine vermeintlich ungerechtfertigte Stigmatisierung und damit verbundene Imageschädigung für die Stadt oder die Region, welche die öffentliche Aufmerksamkeit für die Taten mit sich brächten.
Auch gezielte rechter Überfälle werden in vielen Fällen als „Auseinandersetzungen zwischen eigentlich unpolitischen und gewaltbereiten Jugendgruppen“ entpolitisiert4 – und damit Betroffenen zugleich eine Mitschuld unterstellt. Oder es ist von psychisch gestörten Einzeltätern die Rede, bei denen politisch rechte Motive nicht im Vordergrund stünden.5 Und auch wenn eine Zugehörigkeit (einiger) der Täter*innen zur extrem rechten Szene bekannt ist, die Opfer einem klaren rechten Feindbild entsprechen und stundenlang gequält und erniedrigt wurden werden rechte Tatmotive häufig ausgeblendet oder schnell verneint.6 Und nicht zuletzt die Hoffnungen von Hinterbliebenen, Überlebenden und Freund*innen auf konsequente Ermittlungen und umfassende justizielle Aufklärung oder auf Anerkennung des rechten Tatmotivs werden immer wieder bitter enttäuscht.7
Gedenkpolitiken
Gedenkveranstaltungen brachten bislang nur selten viele Menschen auf die Straßen. In den letzten Jahren ist jedoch eine Veränderung des Gedenkens zu beobachten, die den Rahmen dessen, was Gedenken sein kann, weit aufmacht. Vorangetrieben wird diese Entwicklung von Betroffenen und Überlebenden rechter Gewalt und rechten Terrors, von ihren Angehörigen und von antifaschistischen, antirassistischen und weiteren nicht-staatlichen Gedenkinitiativen.8
Für viele Hinterbliebene und Überlebende rechter Gewalt sind Anteilnahme und Empathie sowie die Anerkennung rechter Tatmotive durch Politik, Staat und Gesellschaft zentral. Ihre Liebsten und die Hintergründe der Taten sollen nicht vergessen und ihr Tod nicht umsonst gewesen sein. Es hat sich gezeigt, dass Abwarten, Hoffen auf und Erbitten von staatlichem Gedenken die Ansprüche, Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen oft nicht erfüllen kann, weil es dazu vielerorts an politischem Willen mangelt. Denn Erinnern muss mehr umfassen als bloße Betroffenheitsgesten oder feierliche Ansprachen politisch und gesellschaftlich Verantwortlicher an den Jahrestagen, zumal hier Hinterbliebene und Überlebende oft nur als Statist*innen auftauchen. Ihre zentralen Wünsche und Forderungen wie die Umbenennung von Straßen oder das Anbringen von Gedenktafeln werden – teilweise mit rassistischen Argumentationsmustern oder Verweis auf Imageverluste – immer wieder zurückgewiesen.9
Und viel zu oft erinnert nichts mehr an rechte Tötungsverbrechen und die Schicksale hinter den Taten, weder an den Tatorten noch anderswo. Gerade bei sozial randständigen und sozial isolierten Getöteten wie Wohnungslosen oder Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gibt es oft keine Hinterbliebenen oder ein soziales Umfeld, welche sich für ein öffentliches Gedenken einsetzten könnten oder wollten. Einige Hinterbliebene versuchen den Verlust auch fernab öffentlicher Veranstaltungen zu bewältigen.
Aber auch dort, wo Städte – oft nach jahrelangem Engagement nichtstaatlicher Akteur*innen – Gedenkorte eingerichtet haben, lassen Formen und Inhalte nicht selten eine unmissverständliche Einordnung oder Kontextualisierung der Taten vermissen.10 Sie sind auch kein Garant für eine langfristige Verantwortungsübernahme oder eine lebendige Erinnerungskultur. Denn mit der Einweihung von Gedenkorten ist immer auch die Gefahr verbunden, dass die Aufarbeitung der Geschehnisse und ihrer gesellschaftlichen Zusammenhänge von politisch Verantwortlichen als beendet angesehen wird und die Instandhaltung des Gedenkortes nichtstaatlichen Initiativen überlassen bleibt.
Das bedeutet, dass Gedenken selbst organisiert werden muss: wenn möglich gemeinsam mit Hinterbliebenen und Betroffenen rechter Gewalt nach deren und den gemeinsamen Vorstellungen.
Nie wieder rechte Gewalt
Mit dem Gedenken an Opfer rechter Gewalt ist immer auch das Anliegen verknüpft zu erreichen, dass sich (tödliche) rechte Gewalt nicht wiederholt. Diese Hoffnung formulieren die Überlebenden der Konzentrationslager genauso wie die rassistischen Brandanschläge der 1990er Jahre, die Angehörigen der vom NSU Ermordeten und weitere Hinterbliebene tödlicher rechter Gewalt. Sie begeben sich an die Orte des größten Schreckens, des größten Leids und Verlustes zurück, um aufzuarbeiten, zu mahnen und damit zu verhindern, dass so etwas wieder passiert. Damit wollen sie auch anderen Betroffenen Mut machen, ihre Geschichten zu erzählen. Und sie wollen dazu ermutigen, nicht wegzusehen und sich auch im Alltag gegen Ausgrenzung und rechte Gewalt einzusetzen. Deshalb heißt Erinnern Verantwortung dafür übernehmen, dass sich solche Taten nicht wiederholen.
Im Gedenken zeigen sich Betroffene und Nicht-Betroffene gegenseitig, dass es einen Teil der Gesellschaft gibt, die diese Geschichten hören will, denen die Hintergründe der Taten, der Umgang damit und gesellschaftliche Verhältnisse, die rechte Gewalt befördern und ermöglichen nicht egal sind. Ein Gedenken an Todesopfer rechter Gewalt kann zumindest ein kleines Stück Gerechtigkeit, Sichtbarkeit oder „Wiedergutmachung“ bedeuten. Daher lohnt es sich auch die Fälle aufzuarbeiten, die schon etliche Jahre oder gar Jahrzehnte zurückliegen.
Strukturelle Logiken aufbrechen und Partei ergreifen
Während die Täter*innen ihren Opfern ihr Menschsein absprechen will Gedenken ihnen wenigstens posthum ihre Würde zurückgeben. Deshalb bedeutet Erinnern an Todesopfer rechter Gewalt, Anteil an ihren Schicksalen zu nehmen und Namen, Gesichter und Geschichten der Getöteten sichtbar zu machen. Weil den Taten die Botschaft innewohnt, dass ganzen Gruppen von Menschen das Existenzrecht abgesprochen wird, muss Gedenken immer auch ein kompromisslose Einstehen für universell geltende Menschenrechte und praktische Solidarität mit gesellschaftlichen Minderheiten umfassen. An Opfer rechter Gewalt zu erinnern heißt nicht zuletzt auch, Ideologien der Ungleichwertigkeit in allen ihren Ausprägungen als existenzielle Gefahr für demokratische und menschenrechtliche Prinzipien wahrzunehmen, zu kritisieren und zu bekämpfen.
Dazu gehört wo nötig auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Agieren der Strafverfolgungsbehörden. Und gerade dort, wo eine offizielle Anerkennung als Todesopfer rechter Gewalt durch Polizei und Justiz ausbleibt, kann ein würdiges, öffentliches Gedenken für Hinterbliebene umso bedeutsamer sein. Denn Erinnern bedeutet hier auch, nachträglich zumindest ein Stück weit Gerechtigkeit herzustellen.
Das Erinnern an rechte Tötungsverbrechen sollte immer auch mit einer Thematisierung der sie ermöglichenden gesellschaftlichen Zustände und Ausgrenzungspraktiken verbunden sein. Erinnern muss heißen, der gesellschaftlichen Realität, die diese Taten und den Umgang mit ihnen hervorgebracht haben, ohne Beschönigung und Entschuldigung ins Auge zu sehen und nach Gegenwartsbezügen zu hinterfragen. Denn nur so können die Verhältnisse, die rechte Gewalt und rechten Terror, wie den des NSU, hervorgebracht haben, verändert werden.
Erinnern heißt deshalb immer auch Partei zu ergreifen für diejenigen, die die rechten Täter*innen aus der Gesellschaft vertreiben und auslöschen wollen. Für diejenigen, die aus dem kollektiven Gedächtnis zu verschwinden drohen, weil sie von der Mehrheitsgesellschaft aufgrund von Zuschreibungen sozialer Herkunft, rassistischen Vorurteilen oder (vermeintlicher) Gesinnung als nicht-zugehörig abgewertet werden. Und für diejenigen, die sterben mussten, weil sie Haltung gegen Rechts oder Zivilcourage gezeigt haben. An Opfer rechter Gewalt erinnern, kann der Anfang einer anderen Gesellschaft sein, weil Solidarität gelebt und Gesellschaft so verändert wird.
Quelle: https://www.rechte-gewalt-sachsen-anhalt.de/media/Bildungsmaterial.pdf
Wir bedanken uns bei der Autorin für die Möglichkeit den Artikel zu veröffentlichen.

„Halle sagt uns nichts, was wir nicht schon vorher hätten wissen müssen.“
Kamil Majchrzak
Auf der Mahnwache vor dem Landgericht in Magdeburg hielt, am zehnten Verhandlungstag im Verfahren gegen den Attentäter von Halle, sprach Kamil Majchrzak vom Vorstand des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Kommandos (IKBD) über die Nachwirkungen der Gewalterfahrungen in den Familien von NS-Verfolgten, seine eigenen Erlebnisse während der sogenannten Baseballschlägerjahre nach der Wende und teilte seine Einschätzungen zum Halle-Prozess.

„Halle sagt uns nichts, was wir nicht schon vorher hätten wissen müssen.“
von Kamil Majchrzak|
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste,
wir kommen gerade aus dem Landgericht, ein weiterer Verhandlungstag gegen den Mörder vom Anschlag in Halle gegen die Menschen in der Synagoge und gegen die Menschen im Kiez-Döner, ein Anschlag der zwei Menschenleben gefordert hat, geht zu Ende. Wir kommen mit sehr gemischten Gefühlen aus dem Gerichtssaal. Wir haben dort einen Nazi vor uns. Einen Holocaust-Leugner. Es ist ein bedrückendes Gefühl, denn man muss ihm nichts nachweisen, was nicht ohnehin feststeht: Er bereut nichts, er steht zu seiner Tat, man muss ihm im Gerichtsverfahren nicht nachweisen, was er getan hat. Der Mörder zieht Grimassen, wenn ihm die Bühne für seine Selbstdarstellung verwehrt wird und er mit den persönlichen Erfahrungen von Nachkommen und den Erlebnissen ihrer Angehörigen, welche die Shoah überlebt haben, konfrontiert wird.
Der Mörder schaut uns ohne Scham in die Augen. Das ist eine neue Qualität, dass ein Mörder einfach zu seinen Hass-Verbrechen steht und nichts bereut, sich der vermeintlichen gesellschaftlichen Anerkennung seiner Tat offenbar sicher ist. Der glaubt, dass seine Zeit in der Gesellschaft noch kommen wird.
Ich möchte Euch sehr herzlich danken dafür, dass Ihr hier diese Mahnwache organisiert. Ich danke Euch auch im Namen der Überlebenden der Shoah und der KZ-Häftlinge aus Polen für Eure Arbeit. Marian Kalwary, der Vorsitzende der Vereinigung der Jüdischen KombattantInnen, der das Ghetto in Warschau überlebt hat, aus ihm geflohen ist und sich später auf der sogenannten arischen Seite versteckt hat, grüßt Euch alle sehr herzlich. Er dankt Euch dafür und möchte Euch stärken, indem was Ihr hier macht!
Sprachlosigkeit überwinden
Der Anschlag von Halle geht uns alle an! Es ist nicht nur ein deutsches Problem. Allein in Polen wurden nach der Befreiung 1945 noch 2.000 Überlebende der Shoah ermordet! Wie stark ist der Hass? Wenn der Antisemitismus nach Auschwitz nicht überwunden wurde, welche Anstrengungen müssen wir nach Halle gemeinsam unternehmen?
Wir müssen deshalb alle diese Erfahrungen aus diesem Gericht heraus und in die Gesellschaft hineintragen. Denn die Sprachlosigkeit, vor der wir stehen, angesichts dieser Morde, dieser Tat, macht uns nicht zugleich auch handlungsunfähig! Ich fragte gestern Marian Kalwary: „Was kannst Du den Betroffenen des Anschlages als Überlebender der Shoah sagen?“ Seine Antwort war: „Wir stehen an Eurer Seite.“ Aber die Vorkommnisse machen auch ihn sprachlos.
Auschwitz hat uns weder weiser noch nachdenklicher gemacht! Sonst wäre diese Tat in Halle wie viele andere antisemitische, antiziganistische und rassistische oder antimuslimische Hass-Verbrechen gar nicht möglich. Gar nicht denkbar! Halle sagt uns nichts, was wir nicht schon vorher hätten wissen müssen. Das Unbehagen dieser Feststellung, diese Sprachlosigkeit macht uns aber nicht handlungsunfähig!
Es geht darum die Voraussetzungen dafür zu zerschlagen, die diese Tat erst möglich gemacht haben; denn sie wurde wieder denkbar gemacht. Wir brauchen Bildung. Trotzdem: Der Hass ist nicht das Resultat von einem Mangel an Büchern oder Zeugnissen von Überlebenden der Shoah.
Die Zeugnisse der Überlebenden zeigen uns eine besondere Ethik auf: Wir müssen achtsamer werden! Wir müssen die Verantwortung für das Gegenüber übernehmen, auch bei Differenzen, Meinungsunterschieden und Abneigungen!
Ihr zeigt es, versucht verschiedene antirassistische Gruppen in einem Bündnis zusammenzubringen, zu mobilisieren. Ich danke Euch auch dafür, dass Ihr den Mut und die Ausdauer aufbringt hier so lange zu MAHNEN!
Aber diese Mahnung muss viel breiter und tiefer in die Gesellschaft hineingetragen werden. Es müssen weitere MultiplikatorInnen und gesellschaftliche Akteur*innen mobilisiert werden. Hier vor dem Landgericht müssen Lehrer*innen und Schüler*nnen sprechen, Vertreter*nnen der Kirchen, Gewerkschaften, der sozialen Verbände und viele andere, um deutlich zu machen, dass dieser Anschlag uns allen galt und sich gegen eine divers-kulturelle Gesellschaft richtet! Deshalb bin ich heute als Nachkomme von polnischen Auschwitz-Überlebenden und Zwangsarbeiterinnen hier.
Ich bin hier auch aus persönlicher Notwendigkeit, auch um mich selbst mit meinen Erfahrungen zu konfrontieren. Wenn man als Prozessbegleiter an einem solchen Verfahren teilnimmt und sich mit solchen Morden, mit solchen Taten auseinandersetzt, versucht man objektiv den Prozess zu begleiten, man versucht es gesamtgesellschaftlich zu betrachten.
Aber es gibt bei solchen Ereignissen immer auch eine sehr persönliche Perspektive. Diese haben viele von Euch. Ihr seid hier aus unterschiedlichen Gründen, sei es aus eigener Betroffenheit, aus Überzeugung, aus einem Verständnis für die ethische Verantwortung den Menschen gegenüber.
Das hat mir persönlich gefehlt: vor 23 Jahren gefehlt. Denn in den 1990er Jahren, den sogenannten Baseballschläger-Jahren im Osten, hat das alles wahrscheinlich auch den Anfang genommen für die jüngsten Verbrechen. Diese verbrecherische Ideologie, die dazu führt, dass man andere Menschen angreift.
Ich möchte Euch deswegen auch eine persönliche Geschichte erzählen. Was mich besonders berührt und aufgebracht hat, ist, dass so viele Menschen, die den Mord an Jana L. vor der Synagoge gesehen haben, einfach vorbeigefahren oder vorbeigegangen sind. Dass sie nicht reagiert haben.
Verantwortung für das Gegenüber übernehmen
Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle, Herr Max Privorotzki hatte heute den Grund erklärt, warum er sich der Nebenklage anschloss. Er erläuterte in seiner Aussage, was ihn bewegt: Er will aufklären und verstehen! Es ist nämlich nicht möglich, dass niemand von der Einstellung des Mörders vorher etwas bemerkt haben will. Es ist nicht möglich, dass der Kauf eines 3-D-Druckers unbemerkt blieb, dass jemand Monate in einer Metallwerkstatt verbringt und sich unbemerkt auf eine solche Tat vorbereitet. Dass es weder die Mutter, der Vater, der Kollege und das Umfeld des Mörders nicht merken.
Dieser Hass, diese Einstellung muss vom Umfeld bemerkt worden sein und das ist das, was uns zu denken geben sollte. Das sollten wir aus dem Gerichtssaal mitnehmen und in die Gesellschaft tragen und unsere Sprachlosigkeit über diese Tat überwinden und deren Entstehungsbedingungen bearbeiten.
Marian Kalwary, ein Überlebender der Shoah und des Warschauer Ghettos sagte mir gestern am Telefon, er ist …
[Ein Fahrradfahrer stört kurz die Rede.]
… Marian Kalwary – mit dem wir in den letzten Jahren als Initiative „Ghetto-Renten Gerechtigkeit Jetzt!“ gemeinsam um die Auszahlung von Ghettorenten für polnische Juden und Roma gekämpft haben, Esther Dischereit, die hier steht, hat uns dabei tatkräftig unterstützt und viele andere – … Er war auch sprachlos angesichts der Mordtaten, obwohl er den Holocaust überlebt hat, weil er keine rationale Erklärung kennt, wie solche Taten 2020 erklärt werden können.
Aber, was man tun kann, es gibt immer die Möglichkeit Widerspruch zu leisten und, genauso wie am 9. Oktober 2019 es auch ein Mann getan hat, der als Kurier gearbeitet hat und an der Synagoge vorbeifuhr, der anhielt, um zu schauen, was mit Jana L. ist.
Was ist mit dieser Frau? Warum liegt diese Frau regungslos auf dem Boden? Er hatte den Mut, er hat angehalten. Gegen ihn wurde ebenfalls die Waffe des Mörders gerichtet! Wir müssen diesen Mut haben, wenn wir sehen, dass Menschen sich auf bestimmte Weise äußern, ihren Hass zum Ausdruck bringen, andere Menschen angreifen: dann müssen wir einschreiten! Wir müssen sofort und frühzeitig agieren.
Damit es eben nicht zu so einer Tat kommen kann. Diese Menschen, die Widerspruch leisten, die eingreifen, die haben mir vor 23 Jahren persönlich gefehlt.
Verletzungen und die Weitergabe von Traumata
In einer November-Nacht 1997, an einem Tag, der in Polen „zaduszki“ heißt, Allerseelen also und man ähnlich wie beim Jiskor-Gebet an Jom Kipur der Verstorbenen gedenkt und sich ihrer erinnert, wurde ich am Gedenkstein für die in der Reichspogromnacht 1938 in Frankfurt (Oder) zerstörte Synagoge angegriffen. Eine Gruppe Neonazis versperrte mir den Weg, da sie das Stadtzentrum als “national befreite Zone” betrachtete. Sie pöbelten mich an, beleidigten und schlugen mich schließlich gezielt von hinten auf den Hinterkopf mit einem Baseballschläger.
Ich erinnere mich an das warme Blut, das am Nacken runter lief. Ein monotones Pfeifen in den Ohren. Ich sah einen Nebel, der vor mir in dieser Novembernacht aufstieg, und ich wusste weder, ob das Wirklichkeit war oder Einbildung. Alles war bruchstückhaft. Ich erreichte den Grenzübergang, ein erschrockener BGS-Beamter, die Sirene des Krankenwagens, die Not-OP, die Blätter im Wind hinter der Scheibe im Krankenhaus. Die Stille, die Einsamkeit, die Angst, die Un-Wirklichkeit. Die fehlende Fähigkeit die Gegenwart vom Vergangenen zu unterscheiden.
„Zaduszki“, das ist ein vorchristlicher Brauch, den eindrucksvoll Adam Mickiewicz in seinen „Dziady“ im XIX. Jahrhundert beschrieb. In Polen glauben einige, dass in dieser Nacht die Seelen der Toten, die aus dem Fegefeuer befreit wurden, bis zum Morgengrauen auf die Erde zurückkehren und über Wege, die sich kreuzen und Friedhöfe wandern. Auf der Suche nach Hilfe, Gebet oder Opfergabe. In einigen Regionen glaubt man, dass die Geister der verstorbenen Kinder nachts als Vögel zurückkehren und am Allerseelentag auf den Ästen sitzen und die Prozession auf dem Friedhof beobachten.
Es verwundert also nicht, dass ich damals, als ich aus dem Krankenbett nach der OP durch das Fenster schaute in meiner Einsamkeit unweigerlich an die Einsamkeit meines Großvaters Stanisław Majchrzak in Auschwitz-Birkenau denken musste. Dieses Gefühl kennen viele Nachkommen. Ich will nicht in ihrem Namen sprechen. Will nur berichten, was es auslöste und wie mich das berührte, was heute die Überlebende des Anschlages auf die Synagoge Rabbinerin Rebecca Blady vor Gericht aussagte.
Später im Verfahren erfuhr ich, dass mehrere Taxifahrer am nahegelegenen Taxistand den Vorgang wohl beobachtet haben müssen. Keiner stieg aus. Eine Straßenbahn fuhr vorbei, sie fuhr sogar langsamer, aber keiner griff ein. Als einige Monate später andere Neonazis mit einer Waffe vor meiner Wohnung auf mich warteten, und mir die Pistole an den Kopf setzten, gab es auch niemanden, der was gesagt hat, der den Mut hatte einzuschreiten, obwohl dann Zeugenaussagen darüber da waren, dass jemand das wieder aus der Straßenbahn beobachtet hat.
Deshalb möchte ich unseren Blick auf diesen Menschen, Herrn S. richten, der damals in Halle bei Jana L. angehalten hat. Er tat dies als Selbstverständlichkeit. Eine einfach menschliche Tat. Eine einfach menschliche Reaktion. Wir wissen nicht viel über Herrn S. Wir wissen nicht, was dieser Mann gefühlt haben kann, als der Mörder auf ihn mehrfach die Waffe gerichtet hat und abdrückte, seine Waffe versagte. Genauso wenig, wie wir wissen können, was ihn veranlasst hat, als einziger anzuhalten und zu schauen, was mit der am Boden liegenden Jana ist. Wir sollten uns ein Beispiel an Herrn S. nehmen! Wir können nicht wissen, ob der Mord an Jana und Kevin so auch hätte verhindert werden können.
Wir wissen aber, dass durch eine einfache menschliche Geste solche Taten in Zukunft verhindert werden könnten. Wenn wir früher widersprechen! Wenn wir früher aufmerksam werden auf Hass! Wenn wir Verantwortung übernehmen!
Und genauso danke ich auch Euch, dass Ihr hier seid und beständig diese Mahnwache hier führt. Ihr verdient große Hochachtung, weil Ihr aufrütteln wollt und dafür bin ich Euch dankbar persönlich aber auch im Namen all der Nachkommen der NS-Verfolgten und Überlebenden der Shoah, die als dritte Generation ihre Stimme gegen Antisemitismus und jede Ideologie der Ungleichwertigkeit erheben möchten.
Als Nachkommen versuchen wir angesichts der Vergangenheit, der Erfahrungen unserer Großeltern und der transgenerationellen Weitergabe der Verletzungen und Traumata in unseren Familien uns aktiv für eine Kultur der Erinnerung einzusetzen, aber wir sind auch in der Gegenwart aktiv gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Hass. Um der Zukunft willen. Denn Erinnerung muss zum Handeln animieren. Denn Erinnern heißt Handeln!
Und ich weiß nicht, was mein Großvater damals in Auschwitz-Birkenau, als er sich im Krankenrevier vor der Selektion durch die SS-Ärzte in einer Latrine versteckte, sich für die Zukunft ausgemalt hat, ob er dachte je Kinder zu haben, einen Enkel. Er hat wahrscheinlich nur an diesen Moment gedacht, dass man noch bis zum Abend überlebt, dann bis zum nächsten Tag, dann noch einen Tag und genau so hat es auch Marian Kalwary erzählt: Es ging immer nur darum den nächsten Tag zu überleben.
Welche Rolle spielt nun die Erfahrung der nazistischen Gewalt gegenüber unseren Großeltern und unserer eigenen Gewalterfahrungen mit Neonazis? Was prägt uns stärker? Die Trauer über die Folter unserer Vorfahren in der Strafkompanie in Auschwitz-Birkenau, oder die Peitschen in den Stollen von Mittelbau-Dora? Der Schmerz nichts tun zu können gegen den Hunger, Durst und die Verzweiflung meines Großvaters, der an den Wahnsinn getrieben wurde in einem verschlossen Vieh-Waggon, als er in den letzten Kriegstagen vom KZ Ellrich nach Bergen-Belsen transportiert wurde … die Hilflosigkeit als Nachkomme nicht mit ihm darüber sprechen zu können? Oder sind es die eigenen Verletzungen durch Neonazis, die Angst seinen Schädel zusammenhalten zu müssen nach dem heftigen Schlag und das pulsierende Hirn zu berühren durch blutüberströmte Finger? Vielfach verschränken sich diese Erfahrungen, transgenerationelle Wunden, die vergessen schienen, werden durch neue Gewalt und Todesangst ausgelöst.
Deshalb bin ich der Nebenklägerin Rabbinerin Rebecca Blady von der Initiative “Base Berlin” sehr dankbar für ihre Worte, die während ihrer heutigen Zeugenaussage unterstrichen haben, wie wichtig es ist die Erfahrungen ihrer Großmutter vor einem deutschen Gericht vorzustellen, die nie selbst die Möglichkeit dazu hatte über ihren Schmerz zu sprechen. Und ich danke Rebecca dafür, dass sie uns heute darauf hingewiesen hat, dass die transgenerationelle Traumaweitergabe für viele Familien ein reales Phänomen ist, das bislang nicht genügend Beachtung in Deutschland gefunden hat. Auch nicht im Zusammenhang mit dem Halle-Prozess.
Die Verweigerung der Anerkennung transgenerationeller Traumaweitergabe ist verbunden mit der Angst die Shoah auch in ihren Nachwirkungen anerkennen zu müssen und in der Folge mit einer neuen Opfer-Gruppe konfrontiert zu werden, wenn die einstigen Shoah-Überlebenden nicht mehr da sind.
Aber es geht nicht darum, dass man zu einer neuen Opfergruppe gehören will, denn wir wollen gar keine Opfer sein. Ich spreche dabei nur im eigenen Namen. Wir sind nicht Objekte der Erinnerung, wir sind eigenständige Subjekte, mit einer Geschichte und eigenen Erfahrungen! Keiner darf die Deutungshoheit über unsere Erfahrungen, Verletzungen und deren Nachwirkung erhalten!
Und wir wollen nicht reduziert werden auf eine bestimmte Erfahrung, die wir gemacht haben hier in Deutschland mit neonazistischer Gewalt. Unsere Leben sind sehr vielfältig! Wir entscheiden selbst darüber!
Wir wollen nicht, dass die Traumatisierung von Nachkommen und der Einfluss der Traumata auf unser Leben, die Einschränkungen, mit denen sie einhergehen, nur um den Preis einer Pathologisierung der Betroffenen anerkannt werden. Dies lenkt von den eigentlichen Taten ab. Es abstrahiert von den konkreten Tätern, ihren konkreten Taten, dem konkreten Umfeld, in dem sie begangen wurden und lenkt von den gesellschaftlichen Bedingungen ihrer Möglichkeit ab!
Es ist nicht nur ein auslösendes traumatisierendes Ereignis, sondern vielfach auch das Nachleben der Taten und ihrer gesellschaftlichen Struktur. Und wie wir danach behandelt werden. Genauso wie die nazistischen Verbrechen gegen unsere Großeltern in einem historischen Kontext eingebettet sind, genauso ist das Attentat von Halle und der Mord an zwei Menschen und auch die Nachwirkungen für die Überlebenden des Anschlages in der Synagoge und im Kiez-Döner in einem konkreten gesellschaftlichen Kontext entstanden.
Deshalb bedanke ich mich sehr dafür, was Du, Ismet Tekin, als Überlebender und Nebenkläger des Anschlages im Kiez-Döner uns sehr selbstbewusst am Rande des heutigen Prozesstages gesagt hast, dass Du auch im Hinblick auf Dein Kind und Deine Teilhabe an dieser Gesellschaft eine Erfahrung zu geben hast, einen Beitrag dazu leisten willst, dass diese Gesellschaft für die Kinder und für uns alle bessere Bedingungen für die Zukunft bereitstellen kann. Deshalb bist Du hier – deshalb sind wir hier!
Und deshalb möchte mich noch einmal bei Euch sehr herzlich bedanken, weil das sehr wichtig ist, zusammen zu halten in dieser schwierigen Zeit. Wir müssen jedoch diese Gedanken und Erfahrungen aus dem Halle-Prozess stärker und breiter in unsere Gesellschaft tragen!
